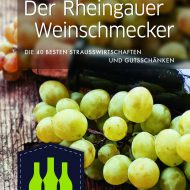Anfang August geht es wieder los, und das mitten in der Nacht: Mit dem Vollernter wird Ferdinand Koegler seine Rebstöcke in der Weinlage Eltviller Taubenberg abfahren. Den Weinberg hat Koegler eigens für diese Produktion vorbereitet, und in der kühlen Nacht wird geerntet, um nur ja keine Gärung des Mostes auf dem Transportweg zu riskieren. Um Wein geht es bei dieser Ernte nicht, denn das Mostgewicht wird um diese Jahreszeit noch nicht einmal 40 Grad Oechsle erreicht haben, während die Säurewerte mit bis zu 25 Promille weit entfernt von einem Trinkgenuss sind.
Doch dieser säuerliche, alkoholfreie Saft unreifer Trauben wird immer gefragter. Nicht unter Weinliebhabern und Sommeliers, sondern von Küchenchefs und Barkeepern. Sie schätzen den veganen und histaminfreien Saft aus Riesling als elegante, milde, sehr aromatische Alternative zu frisch gepresstem Zitronensagt oder Essig und setzen ihn zum Würzen von Speisen ebenso ein wie zur Kreation von Drinks hinter dem Tresen.
Verjus ist ein Naturprodukt, dem außer Vitamin C – zum Schutz gegen Oxydation – keine Stoffe zugesetzt werden. Schonend filtriert und kalt-steril abgefüllt liegt die Haltbarkeit in der Flasche bei mindestens drei Jahren. Verjus, auch Agrest genannt, soll schon zu Hippokrates´ Zeiten als Würz- und Säuerungsmittel beliebt gewesen sein. Koegler nahm vor mehr als 20 Jahren einen Walliser Winzerkollegen zum Vorbild, der sich an Agrest aus der Rebsorte Muskateller versucht hatte. Der säurestarke Rheingauer Riesling schien Koegler noch besser für dieses ungewöhnliche Produkt geeignet. Als Koegler im Jahr 2004 mit den ersten 1000 Flaschen auf den Markt ging, waren seine Söhne Ludwig und Leopold noch nicht geboren.
Inzwischen sind es mehr als 30.000 Flaschen, die das Eltviller Weingut jährlich abfüllt, und Ludwig und Leopold, 21 und 20 Jahre alt, wollen der Erfolgsgeschichte neue Impulse und einen Schub geben. Im kommenden Jahr sollen es schon 50.000 Flaschen Verjus sein, die vorwiegend über Großhändler an die Gastronomie gehen. Auch die Küche des Bundespräsidialamtes bestellt im Weingut jährlich drei große Kisten.
Nach einem sukzessiven Wachstum beim Absatz brachte das Jahr 2019 den Durchbruch. Bei einem Barkeeper-Wettbewerb in Berlin bestand der Siegercocktail „El Rey“ eines bekannte Barkeepers lediglich aus fünf Anteilen Bacardi, zwei Anteilen Zuckersirup und drei Anteilen Verjus. Und im vergangenen Jahr distanzierte ein Münchner Bartender bei einem internationalen Wettbewerb mit seiner Kreation aus Kräuterlikör, Gelbem Muskateller, Gebirgsenzian und Verjus die Konkurrenz. Bei einer Blindverkostung von 14 Verjus hatte das Produkt mit 469 von 500 möglichen Punkten die Nase vorn. Und beim diesjährigen Festival „Cocktail X“ in München war Koeglers Verjus „Produkt des Jahres.“
„Das spricht sich in der Szene rum“, weiß Ludwig Koegler, der mit seinem Bruder regelmäßig bekannte Bars abklappert und renommierte Barkeeper besucht, um das Produkt vorzustellen. Diese schätzen Verjus laut Leopold Koegler den Verjus vor allem wegen der Klarheit, die neben dem Aroma ein weiterer Vorteil gegenüber dem frisch gepressten und dann trüben Zitronensaft sei.
Ludwig und Leopold wollen zum Jahresende eine eigene Vertriebsfirma gründen, um das Momentum beim Verjus zu nutzen. Ihre Exportfühler reichen inzwischen nach Spanien und in die Niederlande. Ferdinand Koegler kann sich vorstellen, dass Verjus auch in Mix-Automaten eingesetzt werden könnte, die auf Knopfdruck Cocktails herstellen und schon wegen der Personalkosten und des Fachkräftemangels künftig zu erwarten seien.
Gut eingeschlagen auch ein erster, „weicher“ schmeckender Verjus-Rosé aus der Zweigelt-Traube, die Koegler ebenfalls schon lange anbaut. Der langfristige wirtschaftliche Erfolg hängt aber auch davon ab, ob es den beiden Brüdern Koegler gelingt, Verjus nicht nur als Basis für neue Kreationen mit Erfolg zu bewerben, sondern den Traubensaft für gängige Drinks einzusetzen. Wenn erst einmal einem Klassiker wie „Whisky Sour“ in den Hotelbars dieser Welt neben Whisky und Zucker auch Verjus statt Zitronensaft beigemixt würde, wären die Marktchancen immens. Mit zwei Drittel Wasser versetzt ist der Verjus ein alkoholfreier und erfrischender Drink für jeden Tag.
Verkauft wird Verjus zum Preis von aktuell zwölf Euro je (Wein-)Flasche, der sich schon aus der geringen Erntemenge in den Weinbergen zu diesem frühen Stadium ergibt. „Wir wollen das Thema Verjus jetzt hochziehen“, sagen die Koegler-Brüder, und nebenbei das Thema Wein nicht vernachlässigen: Zwei alkoholfreie Varianten für ein gesundheitsbewusstes Publikum sind inzwischen als Durstlöscher schon im Koegler-Sortiment.
(aus der FAZ vom 30. Juli 2025)