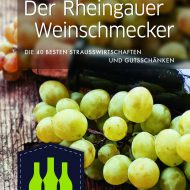Weinbau in der Krise: Für die Winzer im Rheingau kommt es dicke. Während die Kosten steigen, wird es immer schwieriger, ausreichend Kunden zu finden. Welche Folge hat der mangelnde Ausgleich zwischen Nachfrage und Angebote auf die Kulturlandschaft? Der Rheingau bot nicht immer ein nahezu geschlossenes Bild voller Rebstöcke. Über Jahrhunderte war die Landschaft kleinteiliger und stärker als heute parzelliert. Es dominierte eine bäuerliche Mischnutzung. Der Weinbau spielte eine wichtige, aber nicht die alleinige Rolle. Ein Weg zurück in jene Zeit scheint nicht völlig ausgeschlossen. Skeptiker rechnen damit, dass bis zu 700 Hektar und damit fast ein Viertel der Rebfläche von heute rund 3100 Hektar in den kommenden Jahren gerodet werden könnte. Denn die Zeichen der globalen Weinkrise sind im Rheingau sichtbar. Die ökonomischen Signale erscheinen eindeutig.
Bei einer Umfrage des Weinbauverbands unter seinen Mitgliedsbetrieben in diesem Frühjahr wurde dem Vorstand berichtet, dass nicht mehr alle Flächen, die durch in den Ruhestand gehende Winzer frei werden, weiterhin bewirtschaftet werden können. Der Flächenhunger vieler Erzeuger, der in den vergangenen Jahren die Pacht- und Kaufpreise auf ungeahnte Höhen steigen ließ, scheint absehbar gestillt.
Wo gerade – wie zwischen Erbach und Hattenheim – die Flurbereinigung läuft, ist die Lage prekär. Winzer zögern, die neu geordneten Weinberge neu mit Rebstöcken zu bestellen, denn die Kosten sind hoch und die Absatzerwartungen gedämpft. Es gebe Verpächter, die ihre Weinberge den Winzern sogar unentgeltlich anböten, weil sie aktuell keine neuen Pächter finden, hieß es im März im Hauptausschuss des Weinbauverbands. Aus Oestrich wird eine „dramatische Flächenaufgabe“ berichtet. Gleichzeitig sorgen sogenannte Drieschen für Ärger: Das sind nicht mehr bewirtschaftete und verwilderte Weinbergsparzellen, die zum Ausgangspunkt für Schädlinge und Pflanzenkrankheiten werden können.
Sie sind die Symptome einer Weinkrise, die vor dem Rheingau trotz der die Region prägenden, direktvermarktenden Weingüter mit treuem Kundenstamm nicht Halt macht. Die Destillation überschüssiger, nicht verkäuflicher Mengen, wie sie 2023 in Württemberg im Volumen von acht Millionen Litern Trollinger und Portugieser vollzogen wurde, ist für Christian Schwörer nur bei konjunkturellen, nicht aber bei strukturellen Problemen eine Möglichkeit. Der Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbands sprach sich bei der Premiere des neuen Podcasts der Hochschule Geisenheim „Wein im Wandel“ für eine Flächenreduktion aus. An einem Anbaustopp auf neuen Flächen scheint ohnehin kein Weg vorbeizuführen.
Simone Loose, Betriebswirtschafts-Professorin und Leiterin des Instituts für Wein- und Getränkewirtschaft, bringt die Gründe der Misere auf den Punkt: sinkende Haushaltseinkommen und gedämpfte Konsumfreude der Verbraucher, steigende Kosten für Energie und Arbeit bei den Erzeugern in Verbindung mit einer seit mehr als zehn Jahren andauernden globalen Überproduktion. Das hat Folgen. Eine schnelle Besserung ist nach ihrer Ansicht nicht in Sicht. Die Winzer sollten besser nicht nur von einer kleinen „Delle“ in der Absatzentwicklung ausgehen.
Zwar ist das im Jahr 2024 gemessene Delta zwischen globaler Weinproduktion (226 Millionen Hektoliter) und Weinkonsum (214 Millionen Hektoliter) geringer als bei einigen Jahrgängen zuvor, doch ein neues Marktgleichgewicht ist noch nicht erreicht. Die Trinkfreude hat das niedrigste Niveau seit 1961 erreicht. Die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) sieht die Ursachen unter anderem in den Folgen der Inflation, einem veränderten Lebensstil, veränderten sozialen Gewohnheiten und dem Verbraucherverhalten in der jüngeren Generation. Innerhalb Europas sank der Weinkonsum 2024 um 2,8 Prozent auf knapp 104 Millionen Hektoliter. Die Folge dieser Entwicklung sind unter anderem ruinöse Preise auf dem Fassweinmarkt, auf dem sich große Kellereien bedienen, um günstige Weine in die Regale stellen zu können.
Nach Angaben von Hans Rainer Schultz, dem Präsidenten der Hochschule Geisenheim, hat Frankreich für die Rodung von inzwischen 27.000 Hektar Rebfläche fast 110 Millionen Euro aufgewendet. Die Kehrseite dieser Marktentlastung: Laut Schulz werden dadurch bis zu einer Million Tonnen Kohlendioxid in die Umwelt freigesetzt. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts verursacht die Emission jeder Tonne Kohlendioxid rechnerische Schäden in Höhe von rund 180 Euro. Andere Institutionen setzen noch höhere Beträge an. Mithin eine Marktentlastung zu Lasten der Umwelt?
Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Weinbauverbandes in Geisenheim beklagte Präsident Klaus Schneider in der vergangenen Woche, dass der Pro-Kopf-Konsum seit 2020 um zwei Liter gesunken ist. Die Zahl der Weintrinker sei seit 2018 sogar um zehn Prozent zurückgegangen, die der Weingüter seit 2013 um 24 Prozent. Besonders gravierend für die deutschen Erzeuger: Sie büßen in einem schrumpfenden Markt ihre Stellung stärker ein als die Konkurrenz. Denn der deutschen Winzer Marktanteil ist inzwischen auf 42 Prozent zurückgegangen, weil die preissensiblen Kunden eher zu ausländischen Weinen greifen, wenn diese günstiger angeboten werden. Und viele ausländische Erzeuger haben deutlich günstigere Produktionsbedingungen. Laut Schneider sind es gerade die gutverdienenden Wohlstandsbürger im gesetzten Alter, die beim Kauf immer zurückhaltender werden. Zu allem Überfluss rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vom Alkoholgenuss ab.
Die Weinbranche wird damit zurechtkommen müssen, dass die Alterskohorte der bislang regelmäßigen Weingenießer aus ihrer starken Konsumphase sukzessive rauswächst. Was danach kommt, gibt den Winzern wenig Anlass zur Hoffnung. Der Export gilt zwar als Chance, hochwertige Weine zu ordentlichen Preisen zu verkaufen. Doch die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten Trump lässt eine verlässliche Strategie beim Übersee-Export kaum zu.
Weinbaupräsident Schneider beklagt zudem einen wachsenden bürokratischen Aufwand für Winzer. Alles zusammen bringt immer mehr Weingüter an ihre Belastungsgrenze und setze die Branche massiv unter Druck. Darunter fällt die erwartete Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro im Jahr 2026. „Das können wir nicht akzeptieren“, sagt Schneider und verweist auf eine Erhöhung um 76 Prozent binnen zehn Jahren. Doch Ausnahmen für den Weinbau sind kaum zu erwarten. Vorschläge zur Neuregelung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung verhallten in der Politik bisher wirkungslos. Die versprochene Entbürokratisierung bleibe aus: „Wir können es nicht mehr hören, weil wir es nicht mehr glauben.“
Wie auf die Krise reagieren, wenn sich bei einer Dauerkultur wie dem Wein die Erntemengen nicht auf Knopfdruck regulieren lassen? Die Antwort des Deutschen Weinbauverbands lautet Rotationsbrache. Dieses Konzept sieht vor, dass Weinberge temporär nicht bewirtschaftet werden müssen, dabei aber die Pflanzrechte zur jederzeitigen Neuanlage erhalten bleiben. In der Zwischenzeit könnten auf den Weinbergen eigens angelegte Blühflächen dem Artenschutz dienen. Wenn sich die geschlossenen Weinlandschaften deshalb wieder in einen Flickenteppich verwandeln sollten, erwartet der Weinbauverband aber eine Kompensation des Bundes von rund 2000 Euro je Hektar und Jahr.
Im Land Hessen hat der Weinbauverband dabei die Unterstützung des Landes Hessen, auch wenn Weinbauminister Ingmar Jung (CDU) bislang keine konkreten Beträge zusagen will. Jung geht es vor allem um den Erhalt der Steillagen als prägendes Element der Kulturlandschaft und als Argument für den Weintourismus. Von der Hochschule Geisenheim kam inzwischen der Vorschlag einer ökologischer Umgestaltung der Weinberge zulasten der Produktionsmenge und zugunsten von mehr Artenvielfalt. Zudem gibt es im Rheingau Versuche, mit mobilen Sonnenkollektoren über den Rebflächen Solarenergie zu gewinnen.
Minister Jung ist mit der Krise des Weinbaus auch als Aufsichtsratschef der Hessischen Staatsweingüter unmittelbar befasst. Dem Vernehmen nach hat der als GmbH organisierte Staatsbetrieb im vergangenen Jahr einen Verlust in Millionenhöhe eingefahren. Er soll deshalb grundlegend und unter Verringerung der Rebfläche neu geordnet werden. Ein entsprechendes Gutachten soll bis Mitte Juni vorliegen und wird im Rheingau mit Spannung erwartet. Denn anders als noch vor vier Jahren, als Schloss Schönborn die eigene Weinerzeugung im Rheingau aufgab, gibt es keine Gedränge der Winzer um die Flächen. Das Land und sein Weingut trifft die Weinkrise zum ungünstigsten Zeitpunkt.