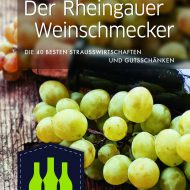Mein Blick schweift ab: von den Rieslingflaschen auf dem Tisch hin zur imposanten Stahleck, die über der „heimlichen Hauptstadt der Rheinromantik“ thront. Da ist Bacharach mit seiner weithin intakten Stadtmauer und den pittoresken Häusern dahinter. Die Perle im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal ist der Geburtsort eines neuen Weinguts, das unter Kennern ein Geheimtipp ist. Denn trotz manch überzeugender Beurteilung in diversen Weinführern ist die Marktpräsenz der Tropfen aus dem Weingut Bär überschaubar. „Der Verkauf ist unsere größte Baustelle“, gibt Hermann Bär unumwunden zu. Noch ist die Gelassenheit ebenso groß wie der Optimismus, dass sich die immense Arbeit in den Steillagen rund um Bacharach bald auszahlen wird. Schon in diesem Jahr könnte eine „rote Null“ in der Bilanz stehen – sofern nicht abermals bedeutende Investitionen getätigt werden müssen.
Wer kauft in diesem Zeiten ein traditionsreiches Weingut und gründet auf dessen Fundamenten sein eigenes? Wer lässt sich auch von Warnungen wohlmeinender Wegbegleiter und Fachleuten der Branche nicht abschrecken? Hermann Bär hat für sich und seine Familie mit dem Erwerb des renommierten Weinguts Bastian einen lange gehegten Wunsch erfüllt und ein beharrlich verfolgtes Ziel erreicht.
Damit hat die Familie ihren Lebensmittelpunkt in der Bodenseeregion und betreibt in Süd-Württemberg und in Freiburg insgesamt sieben Apotheken. Die Liebe zum Wein kam mit dem Vater und dessen gepflegtem Weinkeller, in dem vor allem lieblicher Riesling aus Rheinhessen lagerte. „Ich bin mit Wein aufgewachsen“, sagt Bär. Wenig überraschend also, dass er neben der Apotheke mit später drei Filialbetrieben auch einen Weinhandel aufzog. Weil die Qualität vieler deutscher Weine zu jener Zeit eher mäßig war, konzentrierte sich Bär auf Bordeaux. Die Leidenschaft für den Riesling allerdings blieb davon unberührt. Sohn Peter begeisterte sich ebenfalls, gründete in Freiburg ein Weinfachgeschäft und ließ dem Studium der Betriebswirtschaft noch „Weinbau und Önologie“ in Geisenheim folgen.
Ein für die Übernahme geeignetes Weingut sollte vor allem drei Kriterien erfüllen: eine Immobilie mit Flair und „Seele“, wie es Gabi Bär formuliert. Fokussiert auf den Anbau der Lieblingsrebsorte Riesling und ausgestattet mit besten Lagen, auf denen sich herausragende Tropfen erzeugen lassen. Im Rheingau fand sich nichts Passendes, auch nicht in der Pfalz. Den Durchbruch brachte dann ein Tipp des früheren Verwalters von Schloss Vollrads im Rheingau, Rowald Hepp. Denn Friedrich Bastian, Winzer in achter Generation, war gewillt, sein VDP-Weingut Bastian zu veräußern. Mitsamt der 1880 als Sektkellerei erbauten Immobilie und der kleinen Rheininsel Heyles’en Werth. Die war vor 50 Jahren Drehort für eine Schlüsselszene des Spielfilms „Im Lauf der Zeit“ des Filmemachers Wim Wenders.
Die rund 800 Meter lange Insel ist mit knapp 1,7 Hektar Rebfläche vor allem ein wichtiger Weinbaustandort, denn hier wird der exklusivste der vier Lagenweine erzeugt. Als sich die Familien Bär und Bastian im Jahr 2021 über den Handel einig waren, hatte gerade die Corona-Pandemie begonnen. Das Stammhaus des Weinguts wurde kernsaniert, weil der Investitionsstau sich als beträchtlich herausgestellt hatte. Gleichzeitig wurde die Rebfläche von zunächst sechs Hektar schnell erweitert, weil kleinere Winzer ihre Flächen bereitwillig anboten. Inzwischen werden 21 Hektar bewirtschaftet, von denen aktuell 15 im Ertrag stehen. Viel mehr soll es absehbar nicht werden, auch wenn die Familie offen für die Arrondierung ihrer Flächen ist.
Entstanden ist ein neues Weingut mit neuer Philosophie. Die verbliebenen Bastian-Kunden wanderten ab. „Wir haben bei null angefangen“, sagt Peter Bär. Sein Fokus liegt ganz auf trockenen Weinen, die Charakter, Eleganz und den Charakter der Weinlagen zeigen sollen. Ihm geht es um langlebige Weine. Dafür nimmt sich das Weingut Zeit und gibt den Weinen eine längere Reifephase im Keller. „Unser Lagen brauchen Zeit“, sagt Peter Bär.
Dass nach überstandener Pandemie der Start des Weinguts in den Weinverkauf von der größten Krise des Weinbaus in den vergangenen Jahrzehnten überschattet würde, war Pech. Bär ist bewusst, dass der Weinmarkt nicht sehnlich auf ein neues Weingut mit hochpreisigen Weinen gewartet. Globale Überproduktion und Konsumschwäche befeuern im Handel einen harten Preiskampf. Der Marktanteil des deutschen Weins ging hierzulande deshalb noch stärker zurück als der ausländischen Konkurrenz.
Familie Bär ist deshalb nicht bange: „Wir müssen auf allen Hochzeiten spielen und Präsenz zeigen“, sagte Peter Bär. Das Interesse auf einer Weinmesse in Paris sei gut gewesen. In diesem Jahr beteiligt sich das Weingut erstmals an der Messe Prowein in Düsseldorf. Auch die Gastronomie ist im Fokus, um Sommeliers als Multiplikatoren zu gewinnen. Die neue Marke „Weingut Bär“, das sich in einer kleinen Weinnische bewegt, muss noch mit Strahlkraft aufgeladen werden. Das Mittelrheintal als Weinregion ist zu klein und unbekannt, um Bär den nötigen Schub zu geben: „Wir werden es allein schaffen müssen“, sagt Gabi Bär, und ihr Mann Hermann gibt sich keinen Illusionen hin: „Das ist ein weiter Weg“. (aus der F.A.Z.)