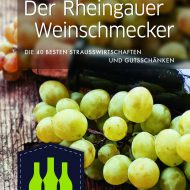Für die deutschen Schaumweinerzeuger beginnen die wichtigsten Wochen des Jahres. Denn Sekt ist und bleibt für die Mehrzahl der Konsumenten – nicht für mich – ein Getränk für besondere Anlässe. Für den Absatz von großer Bedeutung sind daher die Weihnachtstage und der Jahreswechsel. Im November und Dezember entscheidet sich, ob es für die Sekterzeuger ein mäßiges, gutes oder herausragendes Jahr war.
Schon jetzt allerdings zeichnet sich ab, dass sich der Sektmarkt in der globalen Weinkrise resilienter erweist als der Absatz von Stillwein. Während die Weinbranche wegen der allgemeinen Kaufzurückhaltung, den stark gestiegenen Produktions- und Lohnkosten, hohen Preisen für Glas, Verpackung und Energie sowie den Fachkräftemangel über eine der größten Krisen in der jüngeren Geschichte klagt, scheint die Sektbranche bislang glimpflich davonzukommen. Nach aktuellen Branchenzahlen ging der Schaumweinkonsum im Jahr 2024 auf 3,1 Liter pro Kopf zurück. Damit fiel das Minus geringer aus als beim Wein. Im vergangenen Jahr wurden rund 250 Millionen Flaschen Sekt in Deutschland getrunken.
Dass sich Sekt besser schlägt als Wein, hat viele Gründe. Nach Einschätzung von Andreas Brokemper, dem Vorstandschef von Weltmarktführer Henkell-Freixenet, lassen es sich die Deutschen es auch in herausfordernden Zeiten nicht nehmen, die Korken knallen zu lassen. Schaumweine gehörten unverändert zur Genusskultur. Sie müssen allerdings nicht mehr unbedingt Alkohol enthalten. Das beachtliche Wachstum beim Absatz alkoholfreier Schaumweine trägt mit dazu bei, die Krise abzufedern. Brokemper beobachtet, dass beispielsweise bei betrieblichen Feiern neben Sekt auch alkoholfreie Varianten zur Auswahl stehen.
Beim Mitbewerber Rotkäppchen-Mumm heißt es, der alkoholfreie Sektmarkt boome und habe innerhalb von drei Jahren um 52 Prozent zugelegt. Für den deutschen Marktführer Anlass genug, erstmals eine „reine Alkoholfrei-Kampagne“ zu starten. Motto unter Anspielung auf die wichtige Konzernmarke Mumm: „Hab den Mumm, das Leben zu genießen“. Rotkäppchen-Mumm knüpft damit an das Rekordjahr 2024 an, als eine Umsatzsteigerung von sieben Prozent verbucht wurde.
Die Kampagne sei „eine strategische Antwort auf eine dynamische Marktentwicklung“ heißt es. Denn der Markt für alkoholfreien Sekt seit rasant um gut 15 Prozent gewachsen. Der Marktanteil der Alkoholfreien im Sekt- und Champagner-Markt sei um einen Prozentpunkt auf 6,8 Prozent gestiegen. Getragen werde diese Entwicklung vom Wunsch nach Wahlfreiheit: Rund 90 Prozent der Verbraucher hätten alkoholfreien Sekt schon verkostet oder zögen dies in Betracht. Fast 80 Prozent wollten sich beim Anstoßen bewusst für ein Getränk ihrer Wahl entscheiden. Rotkäppchen sieht „Mumm Alkoholfrei“ als Treiber dieses Wachstums: Mit einer Umsatzsteigerung von 16 Prozent übetreffe diese Marke den Durchschnitt. und baue Wiederkaufsrate und Käuferreichweite aus.
Eine reine Alkoholfrei-Werbekampagne kann sich Brokemper für Henkell-Freixenet aktuell nicht vorstellen. Er sieht die Marke im Vordergrund und die Freiheit des Konsumenten, sich für eine Varianten dieser Marke zu entscheiden. Inzwischen gibt es alle großen Marken auch alkoholfrei, von Henkell über Mionetto bis zur hauseigenen Nobelmarke Fürst-von-Metternich, dessen promillefreie Spielart gerade erste der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. „Wir sehen Alkoholfrei als Ergänzung und Vervollständigung des Markenauftritts“, sagt Brokemper im Gespräch mit der FAZ.
Qualitativ sei Sekt immer nur so gut wie der verwendete Grundwein, und die alkoholfreien seien zwischenzeitlich so gut wie das Original. Je nach der – international unterschiedlichen – Höhe der Alkohol- und Sektsteuer können alkoholfreie Schaumweine zudem für den Hersteller lukrativ sein, weil in der Regel keine Preisunterschiede gemacht werden, die Steuer aber entfällt. Allerdings gibt Brokemper zu bedenken, dass die Investitionen in eine möglichst schonende Prozesstechnik hoch seien und stetig fortgesetzt werden müssten. Der dabei anfallende Alkohol kann zwar vermarktet werden, doch ist das Angebot inzwischen hoch und der Marktpreis unter Druck. Brokemper geht davon aus, dass ein Marktanteil der alkoholfreien Schaumweine von zehn Prozent erreichbar ist. Schon jetzt sei in Deutschland jede zwölfte Flasche Schaumwein alkoholfrei. Bei Qualität und Wertigkeit werde es weitere Fortschritte geben, die bald auch ausgewiesene Kenner zufriedenstellen.
(aus der FAZ)