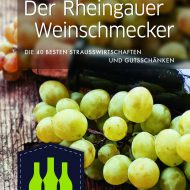Die Technik ist längst soweit: Sprühdrohnen könnten schon heute am Weingut mit Pflanzenschutzmitteln befüllt werden, selbständig starten, per Satellitennavigation die für den Pflanzenschutz ausgewählte Weinbergsparzelle ansteuern, automatisiert das Schutzmittel ausbringen und zum Auftanken und Aufladen wieder zurückfliegen. Für die aufwendige und teure Bewirtschaftung der Steillagen wäre das ein Fortschritt. Gerade in Zeiten der Weinkrise, in denen die Aufgabe nennenswerter Rebflächen droht, weil sie nicht mehr bewirtschaftet werden können, wäre das eine Hilfe. Doch die Regularien verhindern moderne Strategien im Pflanzenschutz. Denn ein Drohnenpilot muss immer in Sichtweite der Drohne sein, auch wenn sie ihre Aufgabe selbständig erfüllt. Und er muss obendrein von einem weiteren Aufpasser unterstützt werden.
Derart praxisferne Regeln müssen fallen. Der Erhalt der landschaftsprägenden Steillagen in einer Phase, in der die Weinbranche mit einer ernsten Absatz- und Konsumkrise von nicht absehbarer Dauer kämpft, ist ein Anliegen des Weinbauverbandes. Wie das gelingen kann, darüber gehen die Meinungen innerhalb der Winzerschaft aber deutlich auseinander.
Für die Hessischen Staatsweingüter schließt Anke Haupt die Aufgabe der Bewirtschaftung einzelner Weinberge nicht mehr aus. Die Staatsweingüter haben mehr als 50 Hektar Steillagen und entsprechend hohe Kosten. „Wir wissen um den historischen Wert der Steillagen“, sagt Haupt mit Blick auf den Wiesbadener Neroberg, dessen 500. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wurde. „Aber muss es jede steile Parzelle sein?“
Bewässerung und „Piwis“ kein Allheilmittel
Nach dem Abgang von Geschäftsführer Dieter Greiner sieht Haupt die Staatsweingüter im Umbruch: „Wir stellen vieles auf den Kopf.“ Dazu gehöre auch, das Portfolio der Weinberge genau unter die Lupe zu nehmen. Eine Bewässerung der Weinberge sei dabei nicht die alleinige Lösung. Denn sie habe keinen Einfluss auf den Ertrag, sondern nur auf die Vitalität der Reben.
Im Weingut der Hochschule Geisenheim lautet eine Antwort auf die Frage nach dem Schicksal der Steillagen: „Piwis“. Die Abkürzung steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die deutlich weniger Aufwand im Pflanzenschutz verursachen und damit auch geringere Kosten. An der Hochschule selbst wird auch für den Einsatz der Drohnentechnik geworben. Diese hätten gegenüber dem Hubschrauber viele Vorteile. Die Flughöhe sei niedriger, der Lärm geringer, der Einsatz flexibler und automatisiert möglich, wenn erst einmal die rechtlichen Hürden gesenkt würden.
Hubschrauber haben beim Pflanzenschutz Vorteile
Davon sind aber nicht alle Winzer überzeugt. Die Lorcher Winzerbrüder Laquai sehen Vorteile beim Hubschrauber-Sprüheinsatz durch die bessere Verwirbelung und Abdeckung der Rebstöcke. Wenn die Laubwand im Hochsommer erst einmal dicht und hoch ist, halten sie autonom fahrende Sprühroboter für geeigneter zur Benetzung der Traubenzone mit Pflanzenschutzmitteln. In Lorch, so ihre Beobachtung, seien bislang kaum Drohnen für den Pflanzenschutz im Einsatz, zumal die Kosten nicht viel niedriger als für den Hubschrauber seien. Aus ihrer Sicht ist eine Ausweitung der Querterrassierung von steilen Weinbergen ein Instrument für den Erhalt der Steillagen. Die Brüder haben inzwischen die Hälfte der 23 Hektar Rebfläche quer zum Hang angelegt, was die maschinelle Bearbeitung stark erleichtert. Dass damit etwa ein Drittel weniger je Hektar geerntet wird, ist in Zeiten nachrangig, in denen genügend Weinberge verfügbar sind. Dann kommt es ihrer Ansicht nach vor allem auf die Produktionskosten je Flasche und nicht auf den Ertrag je Hektar an. Zumal die Querterrassen ein Gewinn für die Artenvielfalt seien.
Aber auch diese Methode ist nicht unumstritten. Der Hochheimer Winzer Gunter Künstler sieht auch Nachteile durch den radikalen Eingriff in die Bodenstruktur eines Weinbergs. Unstrittig ist, dass Verbraucher kaum bereit sind, für Steillagenweine mehr Geld auszugeben. Für Seyffardt eine ungute Folge des Weingesetzes von 1971 und der „Egalisierung“ herausragend guter Weinbergslagen. Seyffardt plädiert dafür, die Wertigkeit der Steillagen bei der Vermarktung stärker hervorzuheben.