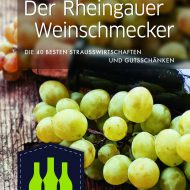Die Zukunft des Weinbaus in den Steilhängen hängt von den Erschwernissen der Bewirtschaftung ab. Flurbereinigungsverfahren können helfen, doch ihre Dauer bedeutet für alle Grundeigentümer eine Nervenprobe
Die Neuordnung eines Flickenteppichs kleiner und kleinster Weinbergsparzellen hin zu größeren, zusammenhängenden Flächen, die maschinell und effizient bewirtschaftet werden können, trägt zum Erhalt der Kulturlandschaft bei. Doch die Flurbereinigung ist eine Generationenaufgabe und Geduldsprobe. Den Lorcher Winzer Gilbert Laquai hat sie fast sein gesamtes Berufsleben begleitet. Die ersten Begehungen der Weinberge fanden schon 1985 statt. Erst jetzt ist das Ende erreicht-
Was macht die Flurbereinigung einer auf etwa 30 Jahre angelegten Dauerkultur wie dem Weinbau so langwierig? Die Gründe sind vielfältig: Eigentümerwechsel durch Verkauf oder Erbschaft, mitunter schwierige Erbengemeinschaften, wechselnde Ansprechpartner in den Behörden sowie sich wandelnde Anforderungen und Wünsche von Winzern und Verwaltung.
Das Flurbereinigungsverfahren in Lorch steht beispielhaft für die Mühsal eines Verfahrens, das vielen Winzern vieles leichter machen soll. Der formelle Beschluss zur Neuordnung fiel im Jahr 1990, und damals hieß die Behörde noch Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Landentwicklung. Für Lorch war das keine neue Erfahrung, denn nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es schon Flurbereinigungsverfahren gegeben. Doch deren Ergebnisse waren nicht zukunftsfähig. „Die Voruntersuchungen haben aufgezeigt, dass aufgrund erheblicher Mängel ein rentabler Weinbau im Verfahrensgebiet nicht möglich ist“, hieß es zu den Gründen im Flurbereinigungsbeschluss zum Verfahren unter der Kennzeichnung „F964“.
Für die Winzer sollte in einem zweiten Anlauf der hohe Zeit- und Kostenaufwand der Bewirtschaftung verringert werden, um Betriebsaufgaben und Brachen zu vermeiden. Die mit einer Neigung von bis zu 40 Prozent steilen Lorcher Weinberge sollen besser für den Einsatz von Maschinen erschlossen, die Wegeführung optimiert, die Wasserführung verbessert und Wildschäden vorgebeugt werden.
„Nebenbei“ sollte zudem der Naturschutz durch die Anlage von Obstbaumwiesen und den Erhalt von Trockenmauern profitieren. Der historische, landschaftlich reizvolle Kaufmannsweg wurde als Wanderweg wiederhergestellt.
Insgesamt wurde für das Verfahren zunächst ein Gebiet von 232 Hektar in den Blick genommen, das in fünf Teilgebiete gegliedert wurde. Es wurde schließlich auf rund 116 Hektar verkleinert. Die Neuordnung dieser Flächen basierte auf einem im Jahr 1995 genehmigten Wege- und Gewässerplanes, der zwischen 1997 und 2014 insgesamt vier Mal abgeändert wurde.
Rund 450 Grundstückseigentümer waren an dem Verfahren beteiligt, in dessen Verlauf 1164 Flurstücke neu geordnet wurden. Dazu mussten bis zum Jahr 2002 die Grundstückswerte aufwendig neu ermittelt werden. Es wurden rund 770 neue Flurstücke ausgewiesen und ihren neuen Eigentümern im Jahr 2023 endgültig zugewiesen. Ende vergangenen Jahres wurde mit den Grundbucheinträgen das Verfahren abgeschlossen. Auf ihren neu zugeteilten Parzellen dürfen die Winzer schon seit 2011 wirtschaften.
Das Verfahren hat mehr als vier Millionen Euro gekostet. Die Stadt Lorch und die Teilnehmergemeinschaft der Grundstückseigentümer, angeführt von Laquai, übernahmen 660.000 Euro. Den Löwenanteil inklusive der Personalkosten finanzierten die Europäische Union, der Bund und das Land Hessen.
Hat es sich gelohnt? Die Winzer sind zufrieden, auch wenn in Lorch selbst jetzt nur noch ein halbes Dutzend aktiv sind. Vor 40 Jahren waren es rund 30. Noch dabei ist Richard Weiler, der das Ergebnis lobt. Aus acht kleinteiligen Parzellen wurde für ihn eine einzige von 5000 Quadratmeter Größe, die sich gut maschinell bewirtschaften lässt. Auch sein Kollege Jochen Neher hebt die das Ergebnis als Gewinn für die Winzerschaft hervor. Die Lorcher Lagen genießen auch bei den übrigen Winzern im Rheingau hohe Wertschätzung. Winzerinnen wie Theresa Breuer aus Rüdesheim und Verena Schöttle aus Johannisberg bewirtschaften schon seit vielen Jahren auch Lorcher Weinberge. Hessen Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) lobte bei einer Feierstunde in den Weinbergen das Engagement von Laquai und Neher. Mit „formal nur 34 Jahren“ sei das Flurbereinigungsverfahren sogar „relativ kurz“ gewesen.
Weinbaupräsident Peter Seyffardt würde sich dennoch mehr Tempo wünschen, denn noch an mehreren Ecken im Rheingau laufen seit Jahrzehnten die Flurbereinigungsverfahren. Sie seien jedoch alternativlos, wenn es um den Erhalt des Weinbaus vor allem in den Steillagen gehe. Flurbereinigungsverfahren seien heute eine Symbiose zwischen Weinbauförderung und Naturschutz. Seyffart lobte die Winzerbrüder Laquai zudem für ihre Pionierarbeit bei der Anlage von Querterrassen in Steillagen. Unverzichtbar sei zudem die Steillagenförderung des Landes, die inzwischen erhöht worden ist. Im vergangenen Jahr profitieren in beiden hessischen Anbaugebieten 134 Weingüter, die 313 Hektar Steillagen zur Förderung angemeldet hatten und 522.000 Euro erhielten. In diesem Jahr will Hessen eine Million Euro bereitstellen je nach Hangneigung zwischen 1500 Euro und 4600 Euro pro Hektar auszahlen. (aus der FAZ im Mai 2025)