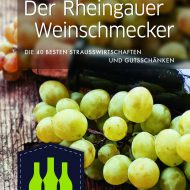Die Krise des Weinbaus wird in Deutschland zu Rodungen im großen Maßstab führen. Steht die Hälfte der Winzerfamilien vor dem Aus? Das vertraute Bild saftig-grüner, geschlossener Weinberge könnte bald der Vergangenheit angehören. Der deutsche Weinbau steht vor einer Zäsur mit gravierenden Folgen für die Kulturlandschaft. Es droht ein Flickenteppich aus bewirtschafteten Weingärten, Brachen, wuchernder Wildnis und landwirtschaftlich alternativ bestellten Parzellen. Für einen geordneten Wandel fehlt es an überzeugenden Strategien und Konzepten. Denn der Wandel kommt für die langfristig denkenden Winzer in einem rasanten Tempo.
Die Gründe sind vielfältig. Seit Jahren gibt es eine globale Überproduktion von Wein und daraus folgend einen verschärften Verdrängungswettbewerb. Die Zurückhaltung beim Alkoholkonsum der jüngeren Generation geht einher mit Alkohol-Warnungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und mit dem „Hinauswachsen“ der Boomer aus der Phase intensiven Weinkonsums. Auch die Gastronomie schwächelt. Die hohe Preissensibilität der Verbraucher in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation trifft die deutschen Winzer hart, weil in anderen Länder günstiger produziert werden kann.
Hinzu kommen stark gestiegene Kosten für Energie, Glas, Verpackungsmaterial und Personal. Der stetig erhöhte Mindestlohn verteuert die Bewirtschaftung vor allem in den von Handarbeit geprägten Steillagen. Gerade sie sind das Symbol für deutschen Spitzenwein. Die Hessischen Staatsweingüter, Deutschlands größtes Weingut und Eigentümerin von mehr als 50 Hektar Steillagen, haben in jüngerer Zeit nicht nur Steillagen an andere Winzer abgegeben, sondern prüfen, ob wirklich jede steile Parzelle noch würdig ist, weiter bewirtschaftet zu werden.
Die Aufgabe und Rodung von Weinbergen ist das letzte Mittel verzweifelter Winzer. Bewässerungsanlagen zur Stabilisierung der Erträge, Querterrassen für eine leichte maschinelle Bewirtschaftung, selbständig fliegende Sprühdrohnen für einen effizienten Pflanzenschutz, Neupflanzung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, die weniger Arbeit machen: das sind einige Optionen zum Erhalt der Steillagen. Aus Sicht des Rheingauer Weinbauverbands wäre zudem ein Label für aufwendig erzeugte „Steillagenweine“ wünschenswert, um höhere Preise am Markt durchsetzen zu können.
Am Ende entscheidet der Verbraucher. Der allerdings, so die Beobachtung des Rheingauer Weinbaupräsidenten Peter Seyffardt, greift schon bei einem Preisunterschied von wenigen Cent eher zur günstigeren spanischen Alternative als zum heimischen Tropfen. In einem schrumpfenden deutschen Weinmarkt ist der Anteil der deutschen Winzer deshalb auf 42 Prozent gefallen – mit fatalen Folgen. Schon vor zwei Jahren wusste sich Württemberg nur durch die finanziell geförderte Krisendestillation unverkäuflicher Rotweine zu helfen. Doch das bringt nur kurzfristige Entlastung. Die Weinkeller werden immer voller, wie die jüngsten Zahlen des Deutschen Weinbauverbands zu den Lagerbeständen zeigen. Das Weingut Markgraf von Baden hat entschieden, 60 Hektar Rebfläche in der Bodenseeregion zu roden, um sie sie fortan für ökologischen Ackerbau zu nutzen. Statt Reben könnten dort Dinkel, Soja, Weizen und Sonnenblumen wachsen.
Der ebenfalls schwächelnde Weinexport ist nur für wenige Winzer ein Ausweg. Ausfuhren in den wichtigsten Exportmarkt, die Vereinigten Staaten, sind durch höhere Zölle deutlich erschwert worden. „Die Zölle, ein schwacher Dollar, steigende Fracht- und Verbrauchsmaterialkosten, höhere Mindestlöhne und gestiegene Energiekosten in Deutschland lassen den Betrieben wirtschaftlich kaum noch Luft zum Atmen“, sagt der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Weinexporteure und Generalsekretär des Weinbauverbands, Christian Schwörer.
Der Niersteiner Winzer und Wein-Podcaster Dirk Würtz umschreibt die Lage so: „Wir haben seit Jahrzehnten zu viel Rebfläche, produzieren am Markt vorbei, sind nicht selbstkritisch und der wesentliche Punkt ist, dass wir es nicht geschafft haben, ein ordentliches Bewusstsein und eine echte Wertschätzung für den deutschen Wein aufzubauen.“
Die krisenhaften Folgen sind in allen Anbaugebieten erkennbar: Altersschwache Weinberge werden zwar gerodet, aber nicht sofort wieder neu bepflanzt. Nach einer Flurbereinigung bleiben neu geordnete Weinbergsflächen länger unbestellt als üblich. Wo gerodete Flächen nicht gepflegt werden, sondern verwildern, bilden sich Hotspots für Schädlinge und Krankheitserreger.
Der Deutsche Weinbauverband gibt inzwischen öffentlich eine „tiefgreifende, strukturelle Krise“ zu. Eine Krise, die nicht vorübergehend ist, wie Analysen von Simone Loose, der Leiterin des Geisenheimer Instituts für Wein- und Getränkewirtschaft belegen. Sie wertet in der „Geisenheimer Absatzanalyse“ regelmäßig die anonymisierten betriebswirtschaftlichen Zahlen von mehr als 600 deutschen Erzeugern aus. Die Absatzdelle könnte demnach zum Dauerzustand werden.
Weinbaupräsident Klaus Schneider verweist in einem Brief an Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) darauf, dass Wissenschaftler einen Flächenrückgang von bis zu 30.000 Hektar „in naher Zukunft“ erwarten. Das wäre knapp ein Drittel der deutschen Rebfläche – oder das Aus für rund die Hälfte aller Winzerfamilien in Deutschland.
Letzteres ist die Befürchtung der in diesem Jahr gegründeten „Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau“. Dieser Verein und seine 160 Mitglieder – vornehmlich aus der Pfalz, Rheinhessen und Baden – haben von ihrer Interessenvertretung eine „schonungslose Offenheit“ vermisst. Anders als der Deutsche Weinbauverband wendet sich die Initiative unter ihrem Vorsitzenden, dem Pfälzer Biowinzer Thomas Schaurer, nicht an die Politik, sondern an die Bürger. Die simple Forderung: mehr Weinpatriotismus.
Schon eine zusätzliche Flasche deutscher Wein pro Kopf und Jahr anstelle einer importierten Flasche Wein sichere die Zukunft der deutschen Winzerfamilie, heißt es. Die Initiative hat den 30. August zum „Tag des Deutschen Weins“ aufgerufen. Dass die heimischen Verbraucher deutschen Wein nicht so zu schätzen wissen, wie es in anderen Ländern für die heimischen Tropfen der Fall ist, „müssen wir Winzer uns selbst ankreiden lassen“, sagt Schaurer. In der aktuellen Lage seien die deutschen Weinberge nichts mehr wert. Die Pacht- und Verkaufspreise seien im Keller, sagt Schaurer, der in der Südpfalz 44 Hektar bewirtschaftet. Die Flächennachfrage sei völlig zum Erliegen gekommen. Wenn sich die Lage nicht schnell bessert, werde es viele Insolvenzen geben. Sein Appell geht an die Einsicht der Weintrinker: Wer die Weinlandschaften zu schätzen wisse, solle zum Tropfen aus deutscher Herkunft greifen. Oder er müsse die Folgen für das Landschaftsbild hinnehmen. Es gehe nicht um Mitleid, sondern um die Frage, „ob der Weinbau und mit ihm die Wertschöpfung in Deutschland erhalten bleiben soll“.
Der Weinbauverband hingegen setzt seine Hoffnungen eher in die Politik als in einen wachsenden Weinpatriotismus der Weintrinker. Der Verband wünscht sich staatliche Zuschüsse für die Pflege vorübergehend nicht mehr bewirtschafteter Weinberge. Die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) hat in dieser Woche ein „Weinbaupaket 2025+“ vorgelegt und sich mit der Forderung nach einem „klaren Bekenntnis zum Kulturgut Wein“ hinter die Forderungen des Deutschen Weinbauverbands gestellt. Für Schmitt liegt auf der Hand: „Ohne Weinbau wäre Rheinland-Pfalz nicht Rheinland-Pfalz.“ Den Winzern empfiehlt sie „weniger Masse, dafür mehr Profil und internationale Wettbewerbsfähigkeit.“ Auch Schmitt zieht die patriotische Karte und ruft Kellereien und Handel ebenso wie die Verbraucher auf, auf regionale Herkunft und Qualität zu achten, damit die Weinwirtschaft wieder in Schwung komme.
Zur Entlastung der Winzer und des Marktes gestattet Rheinland-Pfalz, mit der kostspieligen Neupflanzung von Brachflächen bis zu acht Jahre warten zu dürfen, ehe Pflanzrechte verlorengehen. Das Budget des Landes zur Absatzförderung wurde auf drei Millionen Euro erhöht, um den Verkauf anzukurbeln. Schmitt hat zudem mit ihrem hessischen Kollegen Ingmar Jung (CDU) die Initiative zu einem Treffen aller weinbautreibenden Bundesländer gegeben. Das soll helfen, die notwendigen Veränderungen voranzutreiben, damit das Landschaftsbild keinen Schaden nimmt und die Winzer eine Perspektive haben. (mein Bericht aus der FAZ vom 30. August 2025)