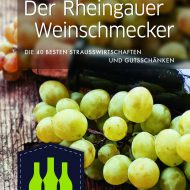Die Weinbranche steckt aus vielerlei Gründen in einer tiefen Krise, aber der Weintourismus erweist sich als widerstandsfähiges und chancenreiches Geschäftsfeld. Zumindest so lange nicht immer mehr Weinberge brach fallen, verwildern und damit das Landschaftsbild beeinträchtigen. Experten erwarten, dass dieses Schicksal mittelfristig bis zu einem Drittel der deutschen Rebfläche von rund 100.000 Hektar drohen könnte. Vor allem die kostspielig zu bewirtschaftenden Steillagen gelten als gefährdet. Schon jetzt mehren sich Brachflächen, auf denen die Neuanpflanzung wegen der Absatzkrise verschoben wurde.
Anmutige Weinlandschaften sind ein touristisches Pfund, mit dem die Winzer wuchern können. Der Geisenheimer Marktforscher Gergely Szolnoki vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft verweist auf den aktuellen „Global Wine Tourism Report 2025“. Es ist die bislang umfassendste Studie zum Weintourismus weltweit. Der Bericht bündelt laut Szolnoki die Erkenntnisse und Erfahrungen von 1310 Weingütern aus 47 Ländern und bietet „einzigartige Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Trends“ der Branche. Bislang hätten den Forschern aber nur „unzureichende internationale Daten“ zur Verfügung gestanden. Nun werde der Global Wine Tourism Report als Teil einer jährlichen weltweiten Umfrage verlässliche und aktuelle Einblicke liefern.
Die Studie ist von der Hochschule Geisenheim University in enger Kooperation mit der Internationalen Organisation für Rebe und Wein, dem Netzwerk der Great Wine Capitals, der Plattform WineTourism.com und UN Tourism, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich für verantwortungsvollen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus einsetzt, erstellt worden.
Zentrales Ergebnis laut Szolnoki: Weintourismus ist ein wichtiger Motor für die regionale Entwicklung, und er stärkt den ländlichen Raum. Zwei Drittel der befragten Weingüter geben an, dass Weintourismus rentabel ist und bis zu 25 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Angebote von Weinverkostungen, Kellerbesichtigungen und Weinbergstouren. Sie seien das Rückgrat des Weintourismus und böten den Kunden „authentische Erlebnisse und persönliche Kontakte“ zum Erzeuger.
Kernzielgruppe ist gemäß der Studie die Altersgruppe der 45 bis 65 Jahre alten Reisenden und Erholungssuchende. Allerdings gewinne die Alterskohorte der 25 bis 44 Jahre alten Touristen wegen ihres hohen Interesses an Bildung, Nachhaltigkeit und Gastronomie immer mehr an Bedeutung. Den Themen Nachhaltigkeit und Authentizität komme dabei großer Wert zu. Sie würden „zu zentralen Bestandteilen der Weintourismusstrategien“, heißt es aus Geisenheim. Der Bericht zeigt laut Szolnoki eindrucksvoll, „wie sich der Weintourismus von einer Nischenaktivität zu einem bedeutenden Treiber für nachhaltige Entwicklung und innovative Marketingpraktiken entwickelt hat.“
In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Weintourismus zu einem dynamischen und profitablen Zweig der Weinbranche entwickelt, der Arbeitsplätze sichere und die Nachhaltigkeit sowie die Bewahrung des Kulturerbes fördere.
Abschreckend für die Weingüter seien allerdings Personalmangel und Zeitdruck. Dennoch plane jedes Vierte der befragten Weingüter, die sich aktuell noch nicht im Weintourismus engagieren, Angebote zu entwickeln. Rund die Hälfte ziehe das zumindest in Betracht. Denn er hohe wirtschaftliche Druck, unter dem viele Weingüter litten, der rückläufige Weinkonsum, überbordende Bürokratie und Auflagen, Arbeitskräftemangel und Digitalisierung erforderten neue Antworten und Strategien. Rund die Hälfte der befragten Weingüter plant daher Investitionen auf diesem Feld: Fast zwei Drittel sähen Weintourismus als ein „Mittel zur Resilienz“ in der Krise.
Szolnoki hat in den zurückliegenden Jahren schon mehrere Studien zu den Perspektiven des Weintourismus erstellt. Für eine davon waren 600 deutsche Winzer befragt, von denen 140 bis zu drei Stellplätze für Wohnmobilisten am Weingut offerieren und dafür bis zu 35 Euro je Nacht verlangen. Das habe sich als erfolgreicher Weg der Neukundengewinnung erwiesen und als Impuls für Nachahmer erwiesen, so Szolnoki
Schon mit dem Abklingen der Corona-Pandemie hatte der Marktforscher einen Aufschwung beim Weintourismus vorhergesagt, weil dieser vom Trend zum Individual- und Qualitätstourismus profitieren werde. Zudem sei das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und den Wert der Natur in der Pandemie gesteigert worden. Das werde langfristig positive Folgen haben und die Bedeutung des Weintourismus für die Weinbauregionen und -betriebe mittel- und langfristig steigen lassen.