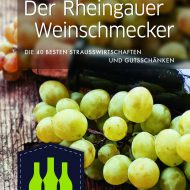Kein Krisen-Jahrgang, aber ein Jahrgang inmitten der Krise. Kaum eine Weinlese wurde in den zurückliegenden Jahren so sehr von die Winzer wenig optimistisch stimmenden Schlagzeilen über den trüben Zustand der Branche begleitet. Globale Überproduktion mit den Folgen eines verschärften Wettbewerbs und hohen Preisdrucks, rückläufige Konsumfreude, ein sich veränderndes Konsumentenverhalten und nicht zuletzt vermehrte Warnungen vor dem Genuss von Alkohol. Hinter den Winzern liegt ein weiteres schweres Jahr, und die Aussichten geben zur Euphorie keinen Anlass. Ob tatsächlich bis zu 30 Prozent der Rebfläche in den kommenden Jahren gerodet werden müssen, wie es Branchenexperten befürchten, ist noch keineswegs ausgemacht. In jedem Fall wird die Krise den Strukturwandel im Weinbau noch beschleunigen. Dass ein ernteschwacher Jahrgang angesichts der vielleicht schwierigen Lage der zurückliegenden Jahrzehnte den Winzern in die Karten spielt, ist allerdings ein Trugschluss. In früheren Jahren hätten die Preise für Most und Jungweine, den die großen
Kellereien den Erzeugern zahlen, bei einer absehbar kleinen Ernte schon während der Lese deutlich angezogen. Das ist aber nicht der Fall. Keinen Grund zum Jubel haben auch jene Winzer mit unverändert stabilen Absatzkanälen, einem starken Vertrieb und treuen Kunden. Sie werden die eine oder andere Nachfrage nicht bedienen können. Und viele Spitzenbetriebe setzen ohnehin nicht auf Masse, sondern auf eine starke Ertragsbeschränkung, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Rückblickend wird 2025 als typischer Klimawandel-Jahrgang in die Annalen eingehen: eine frühe Weinlese im T-Shirt wegen der ungewöhnlich warmen Temperaturen und ein immer kürzeres Zeitfenster, um die Trauben gesund zur Weinpresse zu bringen. Einmal mehr zeigt sich zudem, wie heterogen das Weinland Deutschland ist: Während einige Weinregionen wie Rheinhessen, die Pfalz, die Nahe und auch der Rheingau starke Einbußen verzeichneten, legten die Ahr, die Mosel und Franken zu. Im vergangenen Jahr lagen die Verhältnisse, auch wegen der Spätfröste im April, ganz anders. Der Vermarktung kommt zudem für das Wohl und Wehe vieler Weingüter eine größere Bedeutung zu als die Erntemenge.