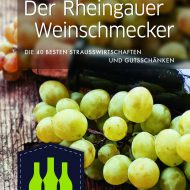Während sich die Winzer auf die heranrückende Lese vorbereiten – und mit der Traubenernte für Federweißen und Sektgrundweine schon begonnen haben-, habenWeinjournalisten, Sommeliers und Fachhändler in Wiesbaden ihr finales Urteil über den deutschen Weinjahrgang 2024 gefällt. Rund 260 Weinexperten waren auf Einladung der 200 deutschen Prädikatsweingüter (VDP) im Kurhaus zusammengekommen, um an drei Tagen fast 500 Weine aus allen 13 deutschen Anbaugebieten zu verkosten.
Das sind zwar längst nicht alle deutschen Spitzenweine, denn nicht jeder qualitätsorientierte Erzeuger ist Mitglied der Prädikatsweingüter. Doch auf den Verkostungstischen in den Kurhaus-Kolonnaden landet alljährlich ein repräsentativer Querschnitt von Weinen aus den anerkannt besten deutschen Weinbergslagen. Die Güte der Weinberge ist das Qualitätsmerkmal im deutschen Weinbau, nachdem der Klimawandel das Erreichen hoher Mostgewichte nahezu mühelos ermöglicht. Auch der Deutsche Weinbauverband hat sich vor vier Jahren von einer Hierarchie verabschiedet, in der die besten trockenen Weine maßgeblich durch Öchslegrade bestimmt werden. Ausgewiesene Lagenweine von hoher Qualität sind seit 2021 das höchste Ziel im Weinbau.
Für den VDP ist die Spitze der Herkunftspyramide, die trockenen „Großen Gewächse“, nicht nur für das Renommee von großer Bedeutung, sondern auch in ökonomischer Hinsicht. Laut VDP liegt der Durchschnittspreis für deutschen Wein bei 4,47 Euro je Liter, während die Einstiegsqualität der VDP-Gutsweine für 11,60 Euro über die Theke geht. Sie stehen für zwei Drittel des Absatzes der VDP-Güter. Dagegen nehmen sich die sieben Prozent „Große Gewächse“ bescheiden aus, doch liegt ihr Durchschnittspreis inzwischen bei 40 Euro je Liter. Im internationalen Maßstab gilt das für Spitzenweine immer noch als günstig.
Es war in Wiesbaden eine Weinverkostung in schwierigen Zeiten. Die Branche diskutiert besorgt die Folgen von Inflation, Kostensteigerungen, Konsumzurückhaltung, Zöllen sowie von höheren Mindestlöhnen und befürchtet einen absehbaren Rückgang der Rebfläche von bis zu 30.000 Hektar – bei rund 100.000 Hektar Gesamtrebfläche in Deutschland – mit dramatischen Folgen für die Kulturlandschaft.
Erst kürzlich hatte der Deutsche Weinbauverband eine „tiefgreifende strukturelle Krise“ der europäischen Weinwirtschaft durch Preisverfall, Überproduktion, Klimawandel und wirtschaftlichen Druck beklagt und die Unterstützung der Politik durch eine „entschlossene nationale Antwort“ gefordert. „Der weinbaupolitische Stillstand in Berlin muss jetzt ein Ende haben“, sagte der deutsche Weinbaupräsident Klaus Schneider und verlangte ein klares Bekenntnis der Politik zu den deutschen Winzern.
Vor diesem Hintergrund ist der Jahrgang 2024 mit seinen aus VDP-Sicht „außergewöhnlich kleinen Erträgen“ ein passender, denn viele Lager sind noch gut gefüllt. Die Qualität ist sehr gut, wie eine VDP Rheingau organisierte Verkostung der Großen Gewächse aus der Region zwischen Lorch und Hochheim zeigte. Für den Rheingauer VDP-Vorsitzenden Wilhelm Weil ist der Weinjahrgang 2024 für eine lange Lagerung und hohes Trinkvergnügen prädestiniert. Aber auch unter den Rheingauer Winzer war die schwierige wirtschaftliche Lage ein Dauerthema.
Die Menge der sehr guten 2024er ist zudem imitiert. Laut VDP war 2010 das letzte Jahr, in dem vergleichbar wenig geerntet wurde. 2024 werde als Jahrgang „mit geringen Erträgen, aber hohe Ausdruckskraft“ in die Annalen eingehen. Als Auswege aus der Weinkrise gelten unter den VDP-Weingütern eine weitere Diversifizierung der Absatzwege und eine Stärkung des Exportes. Bislang hat der – zunehmend schwierigere – Heimatmarkt mit einem Umsatzanteil von 75 Prozent die bestimmende Rolle. Im vergangenen Jahr mussten die VDP-Weingüter einen Absatzrückgang um zehn Prozent auf 35,7 Millionen Flaschen verkraften. Getroffen hat es vor allem jene Weingüter, die auch im Lebensmitteleinzelhandel vertreten sind. Die Discounter, die den größten Marktanteil beim Weinverkauf haben spielen für die VDP-Weingüter hingegen kaum eine Rolle. Die wichtigsten Exportmärkte sind neben den skandinavischen Ländern vor allem die Niederlande, Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Belgien und die Schweiz. Weil die deutschen Winzer angesichts der hohen Produktionskosten keine Billigware erzeugen können, gilt die Konzentration auf Qualität bei niedrigen Erträgen als einzig gangbarer Ausweg.