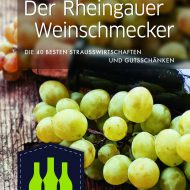250 Jahre Spätlese Weil auf Schloss Johannisberg die Genehmigung zur Weinernte vor 250 Jahren nicht rechtzeitig eintraf, breitete sich ein Schimmelpilz aus. Das Ergebnis änderte die Weinwelt
Die strapazierten Nerven von Johann Michael Engert lassen allenfalls erahnen, denn überliefert ist seine Reaktion auf eine sich vermeintlich anbahnende Missernte nicht. Als der Verwalter, der sogenannten Kellner, von Schloss Johannisberg im Herbst 1775 den Traubenboten nach Fulda entsandte, um vom Fürstbischof die Genehmigung zur Weinlese zu erbitten, rechnete er zweifellos – wie in den Vorjahren – mit einer schnellen Antwort. Doch die ließ auf sich warten.
Während die bäuerlichen Winzer rund um dem Johannisberg nach einem warmen und feuchten Spätsommer die Lese der Trauben zügig vorantrieben, um die Ernte traditionsgemäß vor dem Gallustag am 16. Oktober im Keller zu haben, breitete sich in den fürstbischöflichen Weingärten ein Schimmelpilz aus und färbte die Beeren grau. Erst als der Traubenbote mit zweiwöchiger Verspätung doch noch im Rheingau eintraf, rückte die Lesemannschaft aus Vermutlich ohne große Erwartungen in die Güte des Weins.
Doch am 26. Februar 1776 schreibt Engert nach den ersten Verkostungen im Weinkeller über den Jahrgang: „Der neue Wein ist meistens noch trüb, und haltet immer noch mit einer gewissen Süßigkeit an; man behauptet und hofft, an selbigem etwas außerordentliches der güte halber“. Das klang schon hoffnungsvoll. Am 10. April des Jahres notiert er, dass frühere Jahrgänge im Preis fallen, weil die 1775er vom Johannisberg so gut sind. Zum Tropfen aus dem herrschaftlichen Keller bemerkt er: „solche Weine habe ich noch nicht in Mund gebracht.“ Ein Superlativ.
Der übrige Rheingau urteilt verhaltener über den Jahrgang: In der Rheingauer „Wein- und Geschichtschronik heißt es, zum 1775er: „viel und gut. Dieser Wein hatte anfänglich einen guten Preis, je älter er wurde, um so mehr fiel er im Preis. Viele Kaufleute, besonders die Holländer, wollten seinen Namen nicht mehr hören. Der starke Hagelschlag, den wir Ende August hatten, und die nachfolgenden guten Jahren von 1770 an waren die Ursachen des Abschlagens“.
Dem Schlossweingut kam wohl zugute, dass es frühzeitiger und umfassender auf die Rebsorte Riesling gesetzt hatte als die umliegend wirtschaftenden Winzer. Das ist ein Ergebnis der „fuldischen Ära“ auf dem Johannisberg, die von 1716 bis 1803 währen sollte.
Im Jahr 1716 war der Fuldaer Fürstabt Konstantin von Buttlar mit dem Mainzer Erzbischof Lothar Franz von Schönborn einig über den Kauf des ehedem ältesten Rheingauer Klosters einig geworden. Buttler ließ baufällige Klostergebäude abreißen und leitete den Bau der Schlossanlage ein. Er erweiterte nicht die Rebfläche, sondern ließ auf dem Quarzitboden rund 300.000 Reben pflanzen, vornehmlich Riesling. Ein außergewöhnlicher Schritt für die damalige Zeit, und Schloss Johannisberg nennt sich deshalb „Das erste Riesling-Weingut der Welt“.
Der heutige Chef auf Schloss Johannisberg, Stefan Doctor, geht davon aus, dass der vermehrte Riesling-Anbau eine Reaktion auf ein sich damals abkühlendes Klima war. Dem Riesling sei am 50. Breitengrad und damit der ehemals nördlichen Grenze für den Anbau von Qualitätswein eine höhere Widerstandsfähigkeit zugetraut worden. Butlar sei „ein risikofreudiger Unternehmer“ gewesen.
Die Rolle der Traubenboten ist historisch belegt. Nicht nur im Rheingau. Aber nur wenige dieser Boten sind namentlich bekannt. Auf dem Johannisberg hat der frühere Domänenrat Josef Staab versucht, die Wissenslücken um diese Tradition zu schließen. Herausgefunden hat er unter anderem, dass im Archiv für das Jahr 1718 Rechnungen über einen „Botenlohn“ ausdrücklich vermerkt sind. Allerdings sind viele Unterlagen der damaligen Zeit verlorengegangen. Als gesichert gilt, dass noch im Jahr 1803 Johannisberger Trauen nach Fulda gebracht wurden, um die Leseerlaubnis zu erhalten.
Aus dem Jahr 1775 ist aber weder die Identität des säumigen Boten noch der Grund für sein Fernbleiben überliefert. „Wir wissen es nicht, sagte der Weinhistoriker Oliver Mathias kürzlich bei einer Tagung der Gesellschaft zur Geschichte des Weins an der Hochschule Geisenheim. Das bietet Raum für fantasievolle Geschichten und Legenden. Der Rheingauer Künstler Michael Apitz und Patrick Kunkel haben dies 1988 in einem ersten Comic über „Karl, den Spätlesereiter“ aufgegriffen. Anlässlich des Jubiläums „250 Jahre Spätlese“ ist eine Neuauflage erschienen, in der auch die Wissenslücken über den Ritt des Traubenboten aktualisiert wurden.
Dem unbekannten Traubenboten hat das Schloss schon 1960 ein Denkmal gesetzt, das ein beliebtes Fotomotiv bei den Besuchern auf dem Johannisberg ist. Am Ortseingang – von Winkel kommend – grüßt seit 25 Jahren eine Spätlesereiter-Silhouette alle Johannisberg-Besucher. Und im Fuldaer Schlosshof steht eine schön gestaltete Bronzeskulptur und dokumentiert die Verbindung zwischen Fulda und dem Johannisberg.
„Entdeckt“ wurde die Spätlese gleichwohl nicht in jenem Jahr. Denn dass eine späte Weinlese bisweilen wohltuend auf die Weinqualität wirkt – wenn auch bei reduzierter Erntemenge –, war schon viele Jahre bekannt. Rheingauer Heimathistoriker wie Leo Gros verweisen auf die Tradition der Süßweine in Tokaj und Sauternes. Auch am Steinberg im Rheingau soll es schon vor 1775 das Aha-Erlebnis einer außerordentlichen Weingüte nach Botrytis-Befall der Trauben gegeben haben.
Doch wurde aus Einzelfällen bis 1775 keine Regel, die fortan den Weinbau bestimmte. Auf dem Johannisberg sollte die späte Lese fortan zur Routine werden, und sie sollte nur wenige Jahre später Aufnahme in die amtlichen Reformvorschläge und Empfehlungen für den Rheingauer Weinbau finden, um die Qualität auf breiter Basis zu heben. Historiker Mathias spricht deshalb von einem „Meilenstein der Weingeschichte“.
Die Weinbauern blieben gleichwohl vorsichtig und misstrauisch. Ihnen war das Risiko zu hoch, womöglich die Ernte zu verlieren, wenn die Lese zu spät beginnt.
Goethe schreibt dazu im September 1814 bei einem Besuch in Bingen, „die Güte des Weins hängt von der Lage ab, aber auch der spätern Lese. Hierüber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Wein.“ Ein Zwiespalt, dem die Winzer bis heute nicht entrinnen können. Das Pokern im Herbst um den Beginn der Ernte ist unverändert eine Nervenprobe. Vor allem dann, wenn hohe Qualität das Ziel ist.
Wie der legendäre 1775er aus heutiger Sicht tatsächlich geschmeckt hat, ist nur zu vermuten. Unbestritten ist, dass seinerzeit sein besonderer Geschmack dem Schimmelpilz Botrytis cinerea zu verdanken war. Wenn dieser sich bei feuchtwarmem Herbstwetter und Temperaturen von 15 bis 25 Grad auf vollreifen Trauben ausbreitet, dann perforiert er die Beerenhaut mit der Folge der Verdunstung von Wasser. Das hat eine Konzentration von Zucker und weiteren Geschmacks- und Aromastoffen in den Beeren zur Konsequenz. Weil der Wein dadurch „besser“ wird, sprechen die Winzer von Edelfäule. Sie machen sich dies bis heute zur Erzeugung von edelsüßen Weine bis hin zur Trockenbeerenauslese zunutze.
Ähnlich wie der auf Schloss Vollrads etablierte Cabinet-Wein wurde auch die Spätlese durch das Weingesetz von 1971 entwertet. Nicht die Lage, sondern der Zuckergehalt bestimmten fortan die Güte des Weins. Schloss Johannisberg hatte indes mit seinen Lackfarben eine traditionsreiche Qualitätseinstufung. Hinzu kam nach 1830, dass jeder Verwalter mit seiner Unterschrift auf jeder Flasche für die Qualität des Weines bürgte.
Weil Schloss Johannisberg den Prädikatsweingüter angehört und sich deren Regeln unterwirft, gibt es keine „trockene“ Spätlese mehr, wohl aber eine süße als „Grünlack“. Dieser Wein ist auch wegen der Tradition „nach wie vor der wichtigste im Portfolio“, sagt Stephan Doctor. Er sieht seit einigen Jahren die Phase der Stagnation bei der Nachfrage nach diesen – alkoholärmeren – Weinen wieder wachsen und eine „Renaissance“ bevorstehen. Gerade als Begleiter zur Speisen aus der asiatischen und der modernen Fusion-Küche seien solche ausdrucksstarke Weine gefragt, sagt Doctor, der die Spätlese nicht für einen Dessertwein hält. Für seine 2019er Spätlese hat das Schlossweingut von Weinkritiker Stuart Pigott 100 Punkte für den perfekten Wein erhalten. Mehr geht nicht.
Zum Jubiläum Doctor einen Ausnahmewein kreiert: Eine „Cuvée 100“ Spätlese „Ex Bibliotheca“, also aus der außergewöhnlichen Schatzkammer des Schlosses. Dazu wurden Weine aus den besten Jahrgängen des Schlosses zurück bis zum Jahrgang 1915 zu einer Cuvée zusammengeführt und abgefüllt. Doctor spricht von einer „Multi-Vintage“ Spätlese. Ein Wein der opulent und konzentriert im Glas daherkommt, aber eine außergewöhnliche Frische und Extravaganz zeigt. Das bestätigen Grünlack-Verkostungen ausgewählter Jahrgang bis zurück ins Jahr 1945.
Ganz ähnlich muss es Wilhelm Grimm vorgekommen sein, als er 1883 das Schloss besuchte, dort einen schönen Nachmittag verbrachte und von einem Wein schwärmte, der „der zwar mit Gold bezahlt werden muss, gegen den aber auch aller andere Wein nur eine Art gutartiger Essig ist.“
(mein Bericht aus der FAZ)