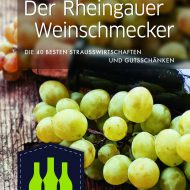Wenn die hessischen Staatsweingüter absehbar weder pleitegehen noch privatisiert werden müssen, dann bedarf es einer grundlegend neuen Strategie. Darüber gibt es nach Informationen der FAZ im neu besetzen Aufsichtsrat der als GmbH organisierten Staatsweingüter breite Zustimmung. Die Perspektiven einer Neuordnung des Staatsbetriebs sind gegeben, seit das zuletzt wieder defizitäre Unternehmen und die Klosterstiftung Eberbach unter einem Dach, dem des Landwirtschaftsministeriums, geführt werden. Minister Ingmar Jung (CDU), dessen Bruder das Erbacher Familienweingut Jakob Jung führt, kennt die „Baustellen“ des Landesweinguts. Und er scheint gewillt, einen radikalen Schnitt zu machen.
Offiziell…..
Tatsächlich hat es das Land Hessen als Eigentümerin versäumt, dem seit 25 Jahren amtierenden Geschäftsführer Dieter Greiner klare Vorgaben an die Hand zu geben, was die langfristig angelegte Strategie des landeseigenen Weinguts ist. Mit mehr als 200 Hektar Rebfläche zwischen Lorch und Hochheim sowie an der Bergstraße zählen die Staatsweingüter zu größten Erzeugern Deutschlands.
Ein klares Konzept allerdings ist nicht zu erkennen. Das Weingut versorgt über eine eigene Kellerei Supermärkte und Großhändler mit Billigwein, der teils aus Rheinhessen stammt und auch dort abgefüllt wird. Es will aber gleichzeitig mit seinen Lagenweinen und den Großen Gewächsen als starker Qualitätserzeuger im Kreis der Prädikatsweingüter VDP wahrgenommen werden. Einem klaren Image ist dieser staatliche Gemischtwarenladen für Wein nicht eben zuträglich.
Dabei hat das Weingut nicht nur Besitz in den meisten der bedeutendsten und besten Weinberge des Rheingaus, sondern seit dem Jahr 2008 überdies – und noch immer – einen der modernsten Weinkeller der Region nebst einer weltweit einzigartigen Schatzkammer. Dennoch wird das Weingut nicht als Flaggschiff und Qualitätsprimus der Region wahrgenommen. Dabei bestreitet kein Weinkritiker, dass die Staatsweingüter das Potential hätten, zu den führenden Erzeugern zu zählen.
In den gängigen Weinführern schneidet das Weingut aber meist nur im grauen Mittelfeld ab. Wer seinen Gästen einen Rheingauer Spitzenwein kredenzen und dafür Anerkennung ernten will, greift kaum zu einem Wein der Staatsweingüter, deren Gesamtsortiment nur schwer überschaubar ist. Das Renommee unter Kennern ist mäßig.
Hinzu kommt, dass die Stiftung Kloster Eberbach und das Staatsweingut, das offiziell als Weingut Kloster Eberbach firmiert, innerhalb der mittelalterlichen Mauern alles andere als wirklich gut zusammenarbeiten. Wegen unterschiedlicher Interessen gibt es Reibungsverluste, die inzwischen auch im Aufsichtsrat als hinderlich für eine gedeihliche Entwicklung wahrgenommen werden.
Was kann und muss ein Staatsweingut leisten, und warum leistet sich ein Bundesland ein Staatsweingut? Trotz immer wieder vorgetragener ordnungspolitischer Bedenken gab und gibt es dem Vernehmen nach im Aufsichtsrat keine Stimmen, die sich für eine Privatisierung des Landesweinguts stark machten. Zumal der beste Zeitpunkt angesichts der gegenwärtigen Krise des globalen Weinbaus um einige Jahre verpasst worden ist. Wenn Minister Jung eine Überzeugung mit seinen für das Weingut verantwortlichen Vorgängern teilt, dann die, dass das Land verpflichtet ist, das Erbe der Zisterzienser, Nassauer und Preußen fortzuführen und nicht abzuwickeln.
Wie aber soll die Rettung gelingen? Bis Mitte Juni soll mit Hilfe externer Berater ein schlüssiges Konzept erarbeitet werden, das in einem überschaubaren Zeitraum verwirklicht werden soll. Vor allem zu zwei wichtigen Punkten scheint es im Vorfeld eine Einigung zu geben: Die Rebfläche soll deutlich kleiner und damit die Produktionsmenge spürbar verringert werden. Wie das gelingen soll, ist offen. Es könnte bei einem drastischen Schnitt dazu führen, dass ganze Weinbaustandorte der Staatsweingüter wie die Bergstraße oder Hochheim in Frage gestellt werden. Zudem sollen die 1998 gegründete Stiftung und das Weingut wieder unter einer Führung vereint werden. Ein überfälliger Schritt, den schon der langjährige Geschäftsführer der Klosterstiftung, Martin Blach, befürwortet hatte.
Mit Spannung wird erwartet, ob Weinguts-Geschäftsführer Dieter Greiner den neuen Weg mitgehen wird oder mitgehen darf. Der seinerzeit erst 30 Jahre alte Agrarwissenschaftler war im Mai 2000 als Nachfolger von Karl-Heinz Zerbe an der Spitze der Staatsweingüter vorgestellt worden. Unter Greiner wurde der Landesbetrieb 2003 in einen GmbH umgewandelt. Der Standort Eltville wurde aufgegeben, der Weingutssitz ins Kloster verlegt und 2008 die vom Land gegen viele Widerstände durchgesetzte Steinbergkellerei eröffnet. Nicht alle Entscheidungen Greiners blieben unumstritten. Als er – kaum im Amt – die Bereitschaft erklärte, die Lage Hattenheimer Mannberg für eine Bebauung preiszugeben, wurde er vom Ministerium gestoppt. Im Alleingang schrumpfte er den markanten Adler auf dem Etikett auf Taubengröße, um ihn im Jahr 2009 ganz von der Vorderseite der Flaschen zu verbannen. Eine Zäsur nach 143 Jahren. Nun steht die nächste bevor.
(aus meinem Bericht in der FAZ)